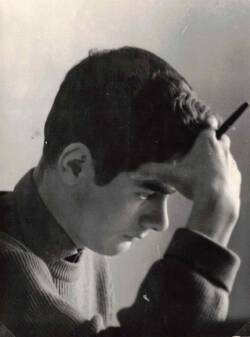Von Birkenfeld nach Paris – Zwischenstation Mainz: Erinnerungen an die Protestbewegungen der 1960er Jahre
Der nachstehende Text entstand 2018, angeregt durch einen Fragebogen, den Landrat a. D. Axel Redmer, der heutige Vorsitzende des Vereins für Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld, 60 Zeitzeugen zugeschickt hatte, um ihre Antworten für eine Untersuchung über die „68er-Zeit und ihre Vorgeschichte” an der Oberen Nahe auszuwerten.[Anm. 1] Mein Zeitzeugnis konnte allerdings nur von begrenztem Wert sein, da ich mich in den 1960er Jahren nach zwei Jahren Bundeswehr (1963–1965) bereits im Studium und anschließend in der Gymnasiallehrerausbildung in Mainz befand. Ich kam nur noch gelegentlich zum Besuch von Eltern, Geschwistern und Freunden nach Birkenfeld, wo ich 1963 meine Schulzeit mit dem Abitur am Staatlich-Neusprachlichen Gymnasium abgeschlossen hatte.[Anm. 2] Mithin stehen die Mainzer Jahre im Fokus meiner „Erinnerungen“: Als Student der Johannes Gutenberg-Universität in Romanistik, Geschichte und Politologie (1965–1969) und anschließend als Referendar während meiner Ausbildung für das Lehramt an Höheren Schulen am Studienkolleg sowie am Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss (1970–1971) erlebte ich die „Revolte“ hautnah mit.
Axel Redmer wollte nicht zuletzt aufzeigen, „wie sehr bereits in den 1950er-Jahren Protestaktionen, die gemeinhin erst der Zeit um 1968 zugerechnet werden, verbreitet waren“, 1968 folglich „die konsequente Weiterentwicklung von Verhaltensweisen (war), die schon lange zuvor die politische Auseinandersetzung bestimmt hatten“.[Anm. 3] Während meiner Birkenfelder Jahre fehlte es mir im frühen Schulalter selbstverständlich noch an Interesse, Wissen und Reife, solch lokale und regionale Entwicklungen wahrzunehmen, geschweige denn in Erinnerung zu behalten. Wenn ich im Folgenden in meinen „Erinnerungen“ dennoch zunächst auf die Birkenfelder Zeit (1950–1963) zurückkomme, so aufgrund Redmers Eingangsfrage: Wodurch wurden Sie politisiert? Die Politisierung meiner Generation begann selbstverständlich bereits im weiteren Verlauf dieser Jahre, geprägt von den historischen Entwicklungen im geteilten Nachkriegsdeutschland und seinem internationalen Kontext. Sie schärften nach und nach unser staatsbürgerliches Bewusstsein. Gymnasium und öffentliches Leben vermittelten uns Wissen und Werte, die anschließend – in Bundeswehrzeit, Studium und Ausbildung – zur Messlatte unserer Kritik an den politischen und gesellschaftlichen Fehlentwicklungen der jungen Bundesrepublik werden sollten.
0.1.1. Politisierungseffekte in den Birkenfelder Schuljahren (1950–1963) und der Bundeswehrzeit (1963–1965)
Als prägende Erfahrungen dieser Jahre erwiesen sich die Teilung Deutschlands infolge des Ost-West-Konflikts mit seiner Systemkonfrontation zwischen Kapitalismus und Kommunismus sowie die Westbindung der Bundesrepublik via Beitritt zum Atlantischen Bündnis (NATO), deutsch-französische Aussöhnung und Einbindung in den europäischen Integrationsprozess. Vor allem folgende Geschehnisse und Entwicklungen sind mir im Gedächtnis geblieben.
0.1.1.Ost-West-Konflikt
In Birkenfeld wurde jährlich mit einer Gedenkfeier vor dem Großherzoglichen Schloss des Arbeiteraufstandes vom 17. Juni 1953 im zweiten deutschen Staat, der im sowjetischen Ostblock verankerten Deutschen Demokratischen Republik (DDR), gedacht. Die Revolte war von der Sowjetarmee gewaltsam niedergeschlagen worden, wie bald darauf, im Oktober/November 1956, der Volksaufstand im ebenfalls unter sowjetischer Herrschaft stehenden Ungarn. Besonders nachhaltig für den Antikommunismus in der Bundesrepublik erwies sich im August 1961 der Bau der Berliner Mauer, eines Grenzbefestigungssystems, mit dem die DDR die Massenflucht ihrer Bürger in den Westen unterbinden wollte.
Der Ost-West-Konflikt sensibilisierte mich als Schüler der Katholischen Volkschule sowie anschließend des Neusprachlichen Gymnasiums schon früh für die menschlichen Tragödien des Kalten Krieges und die Völker- und Menschenrechte. Wenn der Antikommunismus in den 1950er Jahren eine identitätsstiftende und staatstragende Ideologie der jungen Bundesrepublik wurde, so nicht zuletzt, weil sich neben den Schulen auch die Kirchen als prägende Sozialisationsinstanz erwiesen: In katholischen Familien wie der meinigen wurde unter Hinweis auf die Christenverfolgungen im kommunistischen Machtbereich dessen atheistisches Weltbild als fundamentale Bedrohung für den „christlichen Westen“ wahrgenommen.
0.1.2.Deutsch-französische Aussöhnung und europäische Integration
Die Teilnahme an den vom Gymnasium vermittelten deutsch-französischen Schüleraustauschen der Jahre 1958, 1960, 1962 war Ausdruck meines Enthusiasmus über die im Gang befindliche deutsch-französische Aussöhnung, die Bundeskanzler Adenauer und Staatspräsident de Gaulle mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags am 22. Januar 1963 offiziell vollziehen sollten. Besonders de Gaulles Ludwigsburger „Rede an die deutsche Jugend“ vom 9. September 1962 wirkte nachhaltig auf meine Generation. Nicht zuletzt, weil sie unserer bislang noch vagen Vision von einem geeinten Europa ein schärferes Profil gab: Die Bundesrepublik und Frankreich als „Motor“ der europäischen Integration begann sich als Perspektive abzuzeichnen. Hellhörig für die europäische Idee war ich in den späten 1950er Jahren geworden, dank der von Lehrern und Schülern des Birkenfelder Gymnasiums propagierten Aktivitäten der Europa-Union, des medienwirksamsten deutschen Europa-Verbandes der Nachkriegsjahre. Zu einem intensiven und dauerhaften europapolitischen Engagement aber sollte ich erst nach der deutschen Vereinigung (1990) als Hochschullehrer für Rechtssprache an der Universität Paris Nanterre finden.
Meine Studenten- und Lehrerausbildungszeit in Mainz sowie anschließend meine Jahre als DAAD-Hochschullektor und Dozent in Paris – wo ich seit September 1971 Studium und Ausbildung fortsetzte und mich schließlich für die Universitätslaufbahn entschied – waren lange und intensiv der deutsch-französischen Zusammenarbeit gewidmet. Eine Phase, die in Mainz durch die Mitgliedschaft in der Deutsch-Französischen Gesellschaft und die Studierendenkooperation mit der Partneruniversität Dijon geprägt war. Danach in Paris vermittelte ich Studienaufenthalte von jungen Franzosen an deutschen Universitäten und hielt deutschlandkundliche Weiterbildungskurse für Deutschlehrer an französischen Gymnasien ab. Doch bereits in die (freiwillige) zweijährige Bundeswehrzeit direkt nach dem Abitur (1963–1965) fiel das für mich persönlich wichtigste Erlebnis im deutsch-französischen Annäherungsprozess: Als Zeitsoldat eines Panzergrenadierbataillons in Unterfranken nahm ich im Sommer 1963 auf dem Truppenübungsplatz Caylus (Département Tarn et Garonne) an einem der ersten gemeinsamen Militärmanöver nach der Unterzeichnung des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages (Januar 1963) teil: Ich war Dolmetscher im deutsch-französischen Verbindungsstab. Eine Erfahrung, die mich nicht nur von der Notwendigkeit der Westbindung und eines Verteidigungsbündnisses überzeugte, sondern mir auch die Schwierigkeiten der Aussöhnung zwischen Deutschen und Franzosen bewusst werden ließ. Der Höhenrücken der Cevennen war im Zweiten Weltkrieg ein Schwerpunkt des bewaffneten Widerstandes (Résistance) gegen die deutsche Besatzung gewesen. Was Wunder, wenn wir als erste deutsche Soldaten nach dem Kriege in der Region nicht mit offenen Armen empfangen wurden, ja junge Franzosen gar von ihren Eltern gewarnt wurden, nur ja nicht mit uns zu fraternisieren: Starke antideutsche Ressentiments verhinderten Kontakte zwischen Bevölkerung und Bundeswehrbataillon. Während sich die Truppe nach Dienst im Militärlager langweilte, bot sich nur einigen wenigen von uns mit französischen Sprachkenntnissen als Begleiter des Verbindungsoffiziers Gelegenheit zum Gedankenaustausch mit den örtlichen Honoratioren.
0.1.3.Westbindung und Wiederbewaffnung
Gegen Ende meiner zweijährigen Bundeswehrzeit (1963–1965) bekannte ich mich zum militärischen Engagement der USA im beginnenden Vietnamkrieg, wurde er doch zur „Verteidigung westlicher Werte“ geführt. Mit dem Beitritt der jungen Bundeswehr zur NATO (Mai 1955) war die Bundesrepublik in das westliche Verteidigungsbündnis unter amerikanischer Kontrolle integriert worden. Die starke amerikanische Militärpräsenz im Kreis Birkenfeld ging mit der Schaffung zehntausender Arbeitsplätze einher. Gewiss auch deshalb zeichnete sich in der Bevölkerung kein global negatives Bild von der Sieger- und Besatzungsmacht ab. Nach dem Auseinanderbrechen der Kriegskoalition und der Spaltung in Ost und West wies der Antikommunismus das Feindbild eindeutig den Russen bzw. der Sowjetunion zu. Bei den Birkenfelder Bürgern – auch in der Jugend – überwog ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber der westlichen Führungsmacht, wo sich diese im Kalten Krieg nachhaltig als Schutz- und Garantiemacht Westberlins und der Bundesrepublik bewährte – spektakulär unterstrichen durch die Berlinrede des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy vom 26. Juni 1963 („Ich bin ein Berliner“). Es bestand ein breiter Konsens, dass es vor allem den USA zu danken war, wenn nach Freiheit und Demokratie das Wirtschaftswunder „Wohlstand für Alle“ (Ludwig Erhard) bescherte.
Sicherheit und Verteidigung oblagen jetzt aber auch der Bundesrepublik selbst. Als „Parlamentsarmee“ setzte die Bundeswehr auf den Wählerwillen und gab mit dem „Staatsbürger in Uniform“ das Leitbild ihrer Inneren Führung vor – mit dem Gewissen jedes Einzelnen als letzter Entscheidungsinstanz. Es entsprach meinem Selbstverständnis als „mündiger Bürger“, mich über die Bundeswehrzeit hinaus ebenfalls als Student für die verteidigungspolitische Entwicklung zu interessieren: Als Reserveoffizier absolvierte ich freiwillige Wehrübungen in den Semesterferien. Zuletzt 1967 als Kompanieführer einer der ersten Einheiten der neugebildeten Heimatschutztruppe (Territorialreserve) im Birkenfelder Raum, die vom Fischerhof bei Niederbrombach aus operierte.[Anm. 4]
Wenn für Axel Redmer 1968 „die konsequente Weiterentwicklung von Verhaltensweisen“ war, die sich bereits in den Protesten der 1950er Jahren abzeichneten, so meine ich damit vor allem die sozio-kulturelle Entwicklung. In Musik und Tanz, Domänen volkstümlichen deutschen Brauchtums, deuteten sich Tendenzen an, die sich nicht mehr an der Tradition ausrichteten, sondern mit Klängen und Rhythmen einhergingen, die in provokanter Weise ein neues, aus den USA „importiertes“ Lebensgefühl zum Ausdruck brachten. Mit dem Rock ‘n‘ Roll bahnten sich musikalische und tänzerische Neuerungen mit erstmals trendbildender Funktion für Mode und Freizeitverhalten an. Wenn er gemeinhin als Stimulus jugendlichen Aufbegehrens gegen die bürgerlich-patriarchale Gesellschaft der Adenauerschen Nachkriegsära (1949–1963) gilt, so darf jedoch der soziale Hintergrund, d. h. das spezifische Anliegen der „Halbstarken“ als Hauptträger des Jugendprotests, nicht übersehen werden: Eine „Generationseinheit“ junger Arbeiter (Lehrlinge, ungelernte Arbeiter) war darauf aus, sich der Enge des proletarischen Milieus durch die Flucht in „öffentliche Räume“ zu entziehen, um ohne Umschweife vom allgemein wachsenden Wohlstand des Wirtschaftswunders zu profitieren.[Anm. 5] Entschieden konsumistisch orientiert, war die neue Jugendkultur noch frei von konsumkritischem Denken – im Gegensatz zur studentisch geprägten 68er-Generation ein Jahrzehnt später, die von der Systemkritik des Philosophen Herbert Marcuse an „Überflussgesellschaft“ und „Konsumterror“ beeinflusst war.
0.2.2. Protest und Gegenkultur in den 1950er und 1960er Jahren
Die erste Protestkultur nach dem Kriege entstand unter amerikanischem Einfluss. 1954, als die Bundesrepublik ihre erste Fußballweltmeisterschaft feierte, stand in den USA bereits eine ganze Jugendgeneration Kopf, elektrisiert durch „Rock Around The Clock“ von Bill Haley und His Comets. Über die in Europa stationierten US-Soldaten und den Truppensender AFN griff die Rock-‘n’-Roll-Welle auch auf die Bundesrepublik über. Neben Bill Haley zählten Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard und vor allem Elvis Presley zu den ersten Idolen der Nachkriegsgeneration. Viele von uns standen im Banne dieses Musik- und Tanzstils mit ungewohnten Klängen und Rhythmen, der den kulturellen Traditionen große Teile der Jugend abspenstig zu machen schien. Die „befreiende“ Wirkung des Rock ‘n‘ Roll konnte ich zwischen 1956 und 1958 schon als Mittelstufenschüler aus der Birkenfelder Zeitung (Rhein-Zeitung) herauslesen. Sie berichtete über die Krawalle von Jugendlichen im Anschluss an Massenveranstaltungen in deutschen Großstädten, bei denen das Mobiliar von Kino- und Konzertsälen zu Bruch ging. Mit den Halbstarken entstand erstmals eine auf Protest ausgerichtete jugendliche Subkultur in der Bundesrepublik. Ihr Habitus (Haartolle, Jeans, karierte Hemden, Lederjacken, Mopeds, Motorräder) orientierte sich an jungen rebellischen Darstellern aus amerikanischen Filmen, wie etwa James Dean („Denn sie wissen nicht, was sie tun“) und Marlon Brando („Der Wilde“) sowie, eben, an den ersten Rock-‘n’-Roll-Stars.
Als Student sollte es mir am 5. März 1966 vergönnt sein, „Rock Around The Clock“ im NCO-Club der amerikanischen Garnison in Birkenfeld live mitzuerleben, tatsächlich gesungen von dem Mann mit der legendären Schmalzlocke als Markenzeichen: Bill Haley. Mit diesem Hit war 1954 die weltweite Rock-‘n’-Roll-Ekstase und 1956 mit dem Film „Außer Rand und Band“ in der Dortmunder Westfalenhalle die erste Randale in der Bundesrepublik ausgelöst worden. „Rock & Roll ist eine Epidemie, die man als Tanzwut bezeichnen kann“, hieß es am 31. Oktober 1958 in einem Kommentar der Wochenzeitschrift Die Zeit. Diese Einschätzung traf auch auf mich zu. Denn der ungewohnt offene, ausgelassene Tanzstil hatte etwas Schöpferisches an sich, das ich in der klassischen Tanzausbildung vermisste. Immerhin wurden im (vom Gymnasium vermittelten) Tanzkurs von 1960, der traditionsgemäß ebenfalls in gesellschaftliche Umgangsformen und Benimmregeln einführte, Konzessionen an den sich wandelnden Zeitgeist gemacht. Denn bereits der nach dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls von amerikanischen Soldaten nach Europa gebrachte Boogie-Woogie, ein Swingtanz mit afro-amerikanischen Wurzeln, übte eine Faszination auf Jugendliche aus. Gesellschaftlich als „wilde“, Ordnung und Sitten gefährdende „Hottentotten-“ oder „Neger-Musik“ geächtet, wurde er in der Bundesrepublik zunächst hauptsächlich in Bier- oder Milchbars mit Musikbox getanzt. Salonfähig wurde er erst Ende der 1950er Jahre, als er aufgrund verwandter musikalischer Elemente eben als Rock ‘n‘ Roll oder auch als Rock, Jump Blues und Swing getanzt wurde. Wenn diese Neuerungen, zu denen bald auch der Twist gehörte, in Tanzkursen Einlass fanden, so allerdings in europäisierter Form: Die Tanzlehrer verpassten ihnen klar definierte Linien unter Weglassung aller Stilmittel, die als anstößig empfunden werden konnten, wie zum Beispiel beim Twist die kreisenden und schiebenden Bewegungen der Hüfte.
Die Übernahme von Musik und Tanz afro-amerikanischen Ursprungs passte in den 1950er Jahren zur sich abzeichnenden antiautoritären Linie des jugendlichen Protestes gegen die prüden Moralvorstellungen und rigiden Werthaltungen und Verhaltensformen der Elterngeneration. Den revolutionären Klängen und Rhythmen „made in USA“ kam eine Ventilfunktion für die Emotionen und Ängste vieler Jugendlicher zu. Deren Verachtung aus moralischen oder ästhetischen Gründen konnte die Protesthaltung nur noch verstärken. Für mich persönlich allerdings war die Hinwendung zu Rock ‘n‘ Roll, Rock und anderen Varianten des Swing kein Akt der Auflehnung gegen die Eltern. Dafür hatten sie ein zu entwickeltes Musikverständnis. Afro-amerikanische Spirituals und Gospelchöre gehörten gar zum Lieblingsrepertoire der Familie und waren live zugänglich: im Rahmen des Kulturangebotes der amerikanischen Garnison in Neubrücke und Baumholder. Denn mein Vater unterhielt Kontakte zu den „Amis“, da er als Gymnasiallehrer für Englisch und Deutsch ihr Angebot angenommen hatte, ihren Soldaten in Abendkursen Sprach- und deutschlandkundlichen Unterricht zu erteilen. Nutznießer waren nicht zuletzt seine Kinder. Unvergesslich für mich, als ich als Oberstufenschüler – mit Englisch als dritter Fremdsprache – 1960 zu einem Filmabend im amerikanischen Kino in Birkenfeld mitkommen durfte. Premingers Verfilmung von Georges Gershwins Musical „Porgy and Bess“ (1959), mit Sidney Poitier, Dorothy Dandridge und Sammy Davis Jr., sollte sich als prägend herausstellen: Bei aller Treue zum klassischen Musiktheater Oper und Operette, mein Lieblingsgenre war fortan das Musical. Damit liegt es für mich nahe, bereits einen Bogen bis in die 1960er Jahre zu spannen. Denn Protesten und Lebensgefühl dieser Zeit wird wohl kein Kulturprodukt so gerecht wie das 1968 am New Yorker Broadway uraufgeführte Muscial „Hair“ (Musik: Galt MacDermot, Buch: Gerome Ragni, James Rado): Es verdichtete in künstlerischer Form Bürgerrechtsbewegungen, Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg und Hippie-Bewegung („Make love, not war“). Wenn das Musical der jüngeren Generation in der Bundesrepublik ebenfalls unter die Haut ging und mit seinen Songs die Tanzhallen, Diskotheken und Partykeller eroberte, so, weil es die Widerstände gegen die „herrschenden Verhältnisse“ auch hierzulande wiedergab.
Die durch „Hair“ verklärte Hippie-Bewegung zeichnete sich ab 1965 als neue jugendliche Subkultur ab. Auch sie war am amerikanischen Vorbild orientiert. In den USA hatten Nonkonformisten schon in den 1940er Jahre ihre wesentlichen Aspekte thematisiert: Friedensbewegung, freie Liebe, Drogenkonsum, fernöstliche Religionen. „Flower power“, der Protest gegen den Krieg, die Revolution mit friedlichen Mitteln sowie ein von Zwängen und Tabus befreiter Lebensstil gingen mit neuartigen Musikstilen einher: Die amerikanische Folkmusik, zur Gitarre gesungen von Joan Baez und Bob Dylan („Blowin' in the wind“), kam in unserer Generation ebenso an wie die Rockmusik von Jimi Hendrix, Janis Joplin oder den Doors sowie anschließend die grenzensprengende Kreativität der englischen Popbands Rolling Stones und Beatles. Der Lebensstil der Hippies – im August 1969 beim legendären Open-Air-Musikfestival im amerikanischen Woodstock zelebriert – fand hierzulande seinen wohl spektakulärsten Ausdruck bei den Westberliner Kommunarden um Dieter Kunzelmann, Rainer Langhans und Fritz Teufel. Er hinterließ aber auch Spuren im Leben der jungen Generation: gemischte Wohngemeinschaften kamen in Mode. „Make love, not war“ wurde zum geflügelten Wort und in vorehelichen Beziehungen erlebt, seitdem die Antibabypille – seit 1961 auf dem Markt – ungewollte Schwangerschaften verhinderte.
Auch wenn ich zum „Aussteiger“ nicht taugte, so blieb die „Flower-power“-Gegenkultur nicht ohne Einflüsse auf mich und meine Umgebung. Unser verändertes Outfit war augenfällig: lange Haare, Bart, Jeans, T-Shirts – übliche Symbole der Protesthaltung gegenüber dem bürgerlichen Establishment, zumeist beginnend im Elternhaus. „Mit dir gehe ich doch nicht auf die Straße. Was werden die Leute denken?“, reagierte bei einem Besuch in Birkenfeld bezeichnenderweise meine Mutter auf mein verändertes Aussehen. Die älteren Generationen fühlten sich provoziert – wie jener Parkwächter in der Mainzer Nachbarstadt Wiesbaden, der mich und Freunde an einem Sommertag aufforderte, vom gepflegten Rasen vor dem Staatstheater auf „die Gammlerwiese da drüben“ überzuwechseln. Dass Bärtige und Langhaarige allzu oft als „Nichtstuer“ beschimpft wurden, amüsierte mich, wusste ich doch, dass dieser Vorwurf auf die meisten von uns nicht zutraf. 1970/1971, während meiner Lehrerausbildung am Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss in Mainz, hielten sich die (zum Teil konservativen) Fachleiter mit Kommentaren zu Kleidungsstil und Auftreten der ersten Referendare der 68er-Generation zurück: Wir vollzogen den Einstieg ins Schulleben nicht mehr im Anzug mit Schlips oder Krawatte, sondern in legerer Kleidung mit Pullover oder Hemd. Spürbare Animositäten bei den ersten Lehrproben verschwanden rasch, nachdem die Fachlehrer unsere Leistungsbereitschaft erkannten und unser Leistungsniveau ihren Erwartungen entsprach.
Mit dem neuen Look aber waren Uniformen nicht mehr vereinbar. Die Zeit freiwilliger Wehrübungen bei der Bundeswehr war 1968 für mich vorbei. Zur Erklärung gilt es, ausführlicher auf die bewegten Mainzer Jahre eingehen. Damit beantworte ich definitiv auch Axel Redmers Frage nach den politischen Schlüsselerlebnissen bzw. -erfahrungen der 1960er Jahre. Von prägender Bedeutung war zunächst der antiautoritäre Charakter der Proteste, der der bisherigen jugendlichen Gegenkultur systemkritische Akzente verlieh.
0.3.3. Studierendenbewegung und Außerparlamentarische Opposition (APO): die Proteste der 68er und ihre politischen und sozialen Folgen
0.4.3.1. Perspektive antiautoritäre Demokratie

- Zeitgenössischer, an der Universität Mainz im Rahmen von Feierlichkeiten bzw. besonderen Anlässen verwendeter Talar aus den 1960er Jahren.[Bild: Universitätsarchiv Mainz / Foto: Thomas Hartmann]
Die Studierenden drangen auf Abschaffung der in ihren Augen elitären, unzeitgemäßen und unproduktiven Ordinarienuniversität mit ihren noch durch die NS-Zeit geprägten Traditionslinien. Der Slogan „Unter den Talaren – Muff von 1000 Jahren“ (1967) bündelte ihren Protest gegen die ungenügende Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft – ein Vorwurf, der nicht zuletzt den eigenen Eltern galt und damit einen Generationenkonflikt heraufbeschwor.
Mit der Forderung nach Demokratisierung der Hochschulen – ja, des gesamten Bildungssystems – im Rahmen weitreichender Reformen von Staat und Gesellschaft standen Status und Funktion der Universitäten sowie Inhalte und Methoden von Lehre und Forschung auf dem Prüfstand. Mit dieser wesentlichen Forderung verband die Protestbewegung vor allem das Ziel, allen „Akteuren“ – mithin neben den Studierenden auch dem akademischen Mittelbau sowie dem Hochschulpersonal – Mitbestimmungsrechte bei der inneruniversitären Entscheidungsfindung einzuräumen (Drittelparität) sowie den bislang benachteiligten unteren sozialen Schichten der Bevölkerung den Zugang zum Studium zu ermöglichen. Der Demokratisierungsprozess war nicht mehr aufzuhalten und für mich nachvollziehbar. In den Studierendenheimen wurden die Hausordnungen liberalisiert und die Mitbestimmungsrechte der Residenten erweitert. Im Januar 1968, anlässlich eines Besuches der französischen Partneruniversität in Dijon, konnte ich als Mitglied einer Studierendendelegation nicht ohne Stolz auf die Durchsetzung gemischter Studentenwohnheime in Mainz, also das Ende der Geschlechtertrennung, hinweisen.[Anm. 6] Eine Refom, die auch in Frankreich überfällig war und deren Verzögerung einer der Anlässe für die kurz darauf erfolgende Studentenrevolte in Nanterre sein sollte: Sie löste den Mai 1968 aus.
Die Reformdebatte an den Hochschulen zeitigte für Kandidaten für das Lehramt an höheren Schulen wie mich wichtige Erkenntnisse in didaktisch-pädagogischer Hinsicht. Während der Referendarausbildung 1970/1971 versuchte ich zeitgemäßere Unterrichtsformen zu praktizieren, die von interaktiver Gruppenarbeit über audio-linguale Methoden des Fremdsprachenerwerbs (Innovation Sprachlabor) bis zur gezielten Förderung von Schülern aus sozial benachteiligten Familien reichten. Antiautoritäres Lehrerverhalten und sozialintegrativer Unterricht wurden als eine Dimension des Demokratisierungsprozesses von Staat und Gesellschaft betrachtet. Der Abbau von Hierarchien im Lehrer-Schüler-Verhältnis – dank dialogaler Formen im Unterricht sowie dem Ausbau der Schülermitverwaltung (Schülermitverantwortung) – sollten motivierend wirken und die Leistungsbereitschaft steigern.
Ein Angebot, das seitens der Schüler nur bedingt angenommen wurde. Ein antiautoritäres Outfit – lange Haare, Bart, Pullover statt Anzug mit Hemd und Krawatte – sowie ein konvivialer Lehrerdiskurs mochten sympathisch wirken, reichten aber bei Schülern der Mittelstufe (Pubertät) für einen Motivationsschub nicht aus: Hier wurde der innovative Ansatz, also der Bruch mit dem herkömmlichen lehrerzentrierten Unterricht, als Zeichen der Schwäche gewertet. Wo der Lehrer die Machtprobe verliert, ist die Disziplin bekanntlich dahin. In der Oberstufe hingegen war die nötige Reife für einen sozialintegrativen Unterricht vorhanden. Selbstinitiativen der Schüler waren mir willkommen, auch wenn sie im Lehrerkollegium umstritten waren. So setzten die Schüler zum Beispiel im Fach „Sozialkunde“ durch, dass bei der Erörterung des Wehrpflichtgesetzes und damit des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung (Artikel 4, Absatz 3 des Grundgesetzes) ein Vertreter des Verbandes der Kriegsdienstverweigerer (VK) Auskünfte geben durfte – allerdings in Anwesenheit des Fachlehrers für Protestantische Theologie, als Vertreter der Schulleitung. Auch die Schülermitverantwortung (die mir schon vom Birkenfelder Gymnasium her vertraut war – als Mitarbeiter der Schülerzeitung „Schulecho“), wurde ernstgenommen: Als Vertrauenslehrer befürwortete ich – gegen den Willen der Schulleitung – einen Antrag der Schüler auf Erweiterung des Schulhofes. Das Projekt ging durch – mit Unterstützung des Mainzer Bundestagsabgeordneten (und späteren Bundespräsidenten) Richard von Weizsäcker (CDU).
Die Infragestellung der Autorität an den Universitäten hatte auf alle Bereiche des Erziehungssektors übergegriffen. Das traditionelle Erziehungssystem geriet als Ganzes in die Kritik, auf der Grundlage vor allem von Theorien der Frankfurter Schule (Horkheimer, Fromm, Marcuse, Adorno, Habermas): Die in der bürgerlichen Familie entwickelten Autoritätsverhältnisse – so das Credo der Vordenker – begründeten die Herausbildung autoritärer Charaktere und erwiesen sich als Nährboden für die Herausbildung des deutschen Faschismus. Die antiautoritären Erziehungskonzepte griffen zum Teil Überlegungen auf, die in der Tradition der Reformpädagogik der Jahrhundertwende und des Rousseauschen Erziehungsideals standen. Demnach sollte Erziehung – wie in selbstverwalteten Kindergärten (Kinderläden) zu beobachten war – möglichst frei von Zwängen sein, damit sie nicht zum Hemmnis für die freie Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes wurden. Vertreter der Antipädagogik gingen sogar so weit, Erziehung grundsätzlich mit „Entmündigung“ und „Manipulation“ gleichzusetzen. Die insgesamt gesehen diffusen Vorstellungen von antiautoritärer Erziehung waren schwer auf einen Nenner zu bringen. Legt man ihre Praxis in Kinderläden zugrunde, so reichte ihr Spektrum von der Förderung von Persönlichkeitsmerkmalen wie Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und Kreativität, über die Liberalisierung der Reinlichkeits- und Ordnungserziehung bis hin zur Enttabuisierung und „Befreiung“ der kindlichen Sexualität.[Anm. 7] Das antiautoritäre, idealistisch „gegen die Herrschaft von Menschen über Menschen“ gerichtete emanzipatorische Selbstverständnis der Studierendenbewegung zeigte sich in der Tat am spektakulärsten bei dem Versuch, die bis dahin geltende Sexualmoral zu überwinden. Mit dem Aufkommen der Antibabypille (1961) waren die Geschlechterbeziehungen urplötzlich einem Wandel unterworfen, der vor allem die bis dahin geltenden Vorstellungen von vorehelichen Beziehungen sprengte. Erstmals konnten Sexualität und Empfängnis voneinander getrennt werden, mit der Folge eines (ab sofort) angstfreieren Umgangs mit Sexualität. Ein Trend, dem sich kirchlich-konservative Kreise vehement widersetzten. Als Mitglied des katholischen Studentenvereins „Unitas-Willigis“ erlebte ich in Mainz erbitterte Auseinandersetzungen zwischen den Aktiven („Der Christ, betrogen um seine Geschlechtlichkeit?“) und ihren Altherren-Verbänden um die päpstliche Enzyklika „Humanae vitae“ vom 25. Juli 1968, die bis heute grundlegend für das Nein der Katholischen Kirche zur künstlichen Empfängnisverhütung ist. In seinem Lehrschreiben legte Papst Paul VI. dar, dass vor dem Hintergrund der Beachtung des natürlichen Sittengesetzes „jeder eheliche Akt von sich aus auf die Erzeugung menschlichen Lebens hingeordnet bleiben“ müsse. Kondome und Pille seien „moralisch verwerflich“, verleiteten sie doch zu ehelicher Untreue und trügen dazu bei, die Frau zum Sexualobjekt zu degradieren. Der von uns unternommene Versuch, die „Unitas“ bundesweit zu reformieren (Mainzer Modell) und im Sinne von Ökumene (Zulassung von Andersgläubigen) und Gleichberechtigung (Aufnahme von Kommilitoninnen) zu öffnen, scheiterte 1969 am Veto der konservativen Altherren-Verbände.
Die Studierendenbewegung gab den Anstoß zur Bildung einer Außerparlamentarischen Opposition (APO), einer Sammlungsbewegung linksliberaler, linksdemokratischer und pazifistischer Kräfte – darunter aktive Gewerkschafter. Denn unter der seit 1966 amtierenden Regierung der „Großen Koalition“ aus CDU/CSU und SPD, den beiden Volksparteien, war die parlamentarische Gegenmacht zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft war: Die einzige Oppositionspartei, die liberale FDP, verfügte über lediglich 9,5 Prozent der Abgeordnetensitze im Bundestag. Mit der Bildung der APO wurde die soziale Basis des studentischen Protests erweitert: Er griff auf die Zivilgesellschaft über. Die antiautoritäre Grundstimmung der Protestbewegung stellte die tradierten Konzepte von politischer Organisation und Aktion und somit das Repräsentationsmonopol von Parteien und intermediären Verbänden in Frage: Individualistischer, anti-institutionalistischer und antibürokratischer Prägung, sah die Bewegung in Formen kollektiver Selbstbestimmung und bürgernaher Politik eine Triebfeder der für notwendig erachteten emanzipatorischen Sozialisation.
0.5.3.2. Notstandsgesetze, Vietnam-Krieg, Neue Linke: die politischen Kontroversen der 1960er Jahre
Die bedeutendsten Aktionsträger von Studierendenbewegung und APO waren nach dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) die Republikanischen Clubs, mitunter auch unter dem Namen Clubs Voltaire bekannt: informelle „antibürokratische“ Zentren im Dienste der „Vermittlung von Theorie und Praxis“ (Oskar Negt). An den Modellen der Rätedemokratie orientiert, diskutierten und erprobten sie zeitgemäße Varianten der direkten Demokratie. Von den Clubs gingen auch Impulse für neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik aus. Vor allem für die Frauenbewegung: Über Selbsthilfegruppen und Netzwerke wurde auf die Benachteiligung der Frauen aufmerksam gemacht und öffentlichkeitswirksam ihr Recht auf Selbstbestimmung, z. B. in der Frage des Schwangerschaftsabbruchs (Abschaffung des § 218) sowie auf Gleichberechtigung in Politik und Gesellschaft eingefordert. Ich unterhielt lockere Kontakte zum Republikanischen Club in Mainz. Antiautoritär, antikapitalistisch, antimilitaristisch profiliert, agierte er auch antirassistisch, indem er gegen alte und neue Nazis mobil machte. Bei den Diskussionen in der Klubkneipe in der Altstadt hinter dem Dom beriefen sich erfahrene Gewerkschafter, junge Wissenschaftler, politisierte Hippies und Künstler wie der pazifistische Kabarettist Hanns Dieter Hüsch gar auf die Werte-Trikolore der Französischen Revolution (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit). Berechtigterweise, denn von März bis Juli 1793 bestand unter dem Schutz der französischen Revolutionstruppen eine Mainzer Republik: Das erste auf bürgerlich-demokratischen Grundsätzen beruhende Staatswesen auf deutschem Boden.
In der rheinland-pfälzischen Hauptstadt kam es nicht zu spektakulären Protestaktionen wie 1968 zum Beispiel in West-Berlin: mit militanten Kampagnen gegen den rechtslastigen Springer-Konzern (Enteignet Springer) oder 1969 mit demonstrativen „Beratungen“ für Kriegsdienstverweigerer und Deserteure (Wehrpflichtige konnten in West-Berlin nicht mehr einberufen werden). Die neue Landesregierung aus Christdemokraten (CDU) und Liberalen (FDP) ging 1969 nicht auf Konfrontationskurs zur Jugend. Im Gegenteil: Der junge Ministerpräsident Helmut Kohl, der gerade den Generationenkonflikt in der Landes-CDU zu seinen Gunsten entschieden (und sich der „Altlast“ Peter Altmeier, seines Vorgängers, entledigt) hatte, zeigte Sympathien für die Bewegung. Disziplinarischen Maßnahmen gegen Studierende stand er reserviert gegenüber. Ich gehörte zu den Teilnehmern einer Kundgebung des Allgemeinen Studentenausschusses (ASTA) vor der Staatskanzlei,[Anm. 8] denen Kohl Rede und Antwort stand. Die von Bundesinnenminister Ernst Benda vorgelegte Reform des Hochschulordnungsrechtes missfiel ihm: Er wünschte eine landespolitische Regelung mit der Einbeziehung des Ordnungsrechtes in ein neues und umfassendes Hochschulgesetz. Die im Dezember im Kabinett diskutierten Thesen für ein solches Gesetz wurden vom liberalen Koalitionspartner verworfen: Sie erschienen ihm zu staatsinterventionistisch. Zu einem offenen Konflikt in der Koalition kam es allerdings nicht mehr, weil Studierendenbewegung und APO bereits im Niedergang begriffen waren: Kohl sah sich keinem Druck mehr von außen ausgesetzt und zog die Thesen stillschweigend zurück, was kein öffentliches Aufsehen erregte.
Der Republikanische Club in Mainz trug die bundesweit angelegten Initiativen der APO mit, vor allem den Sternmarsch nach Bonn vom 11. Mai 1968: Studierende und Intellektuelle, Gewerkschafter, pazifistische „Ostermarschierer“ („Kampf dem Atomtod“), Aktivisten politischer und kirchlicher Gruppen protestierten zu Zehntausenden gegen die geplanten, auf parlamentarischem Wege aber nicht zu verhindernden Notstandsgesetze: Sie wollten Grundrechtseinschränkungen der Staatsorgane zur Aufrechterhaltung der „rechtsstaatlichen Ordnung“ nicht hinnehmen. Gemäß Art. 87a GG durfte die Regierung zur Behebung eines inneren Notstandes („zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes“) fortan zwecks Unterstützung von Polizei und Bundespolizei den Einsatz der Bundeswehr verfügen.
0.5.1.Vietnamkrieg und Antiamerikanismus
Mit meiner Beteiligung an der Bonner Kundgebung ging ich 1968 sichtlich auf Distanz zur Bundeswehr. Die Zeit freiwilliger Wehrübungen war für mich vorbei. Der „Zug der Zeit“ machte sich bemerkbar. Denn bezeichnenderweise stieg die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in den Tagen der Studierendenbewegung in einem solchen Maße, dass Heeresinspektor General Schnez die Sorge hatte, „die Bundeswehr könne ihren Auftrag nicht mehr erfüllen“.[Anm. 9] Für mich selbst kam eine Kriegsdienstverweigerung nicht in Frage: Sie war mit meiner Vorstellung von einer “wehrhaften Demokratie” in Zeiten anhaltender internationaler Spannungen nicht vereinbar.
Die Jugend stand unter dem Eindruck der weltweiten Demonstrationen gegen den Krieg in Vietnam: Eine (durch das Musical „Hair“ spektakulär gefeierte) Friedensbewegung, vom Antiamerikanismus geprägt, nachdem die Aufbruchstimmung der idealisierten kurzen Amtszeit des US-Präsidenten John F. Kennedy (1961–1963) nach dessen Ermordung verflogen war und die USA seit 1965 militärisch im Vietnam-Konflikt intervenierten. Unter dem Impuls des „Free Speech Movement“ an der kalifornischen Universität Berkeley (1964) formierten sich binnen kurzem landesweite Proteste, beruhend auf der Interaktion von Studierendenbewegung, Bürgerrechtsbewegung (Martin Luther King) und Antikriegsbewegung. Der Vietnamkrieg wurde zum Fanal für eine weltweite Gegenbewegung und Strategien des „bewaffneten Kampfes gegen Kolonialismus und Imperialismus“. Der Antiamerikanismus erwies sich als identitätsstiftend für den militanten Diskurs. Er erklärt die positive Rezeption der kubanischen Revolution (1959) durch die 68er sowie ihre Solidarität mit den nach Unabhängigkeit strebenden Völkern in der Dritten Welt. „Marxisten-Leninisten“ wie Ho Chi Minh (Vietnam) oder Ernesto Guevara (Kuba) wurden zu Galionsfiguren des anti-imperialistischen Kampfes gegen die USA. Eine Tendenz, die vom sowjetischen Ostblock sowie der Volksrepublik China gefördert wurde und sich politisch auszahlte: Eine Reihe von neuen Staaten orientierte sich am „Entwicklungsmodell“ der kommunistischen Führungsländer.
Der Antiamerikanismus der Protestbewegungen führte zwangläufig dazu, die Rolle der Bundesrepublik als Bündnispartner der Vereinigten Staaten zu hinterfragen. Je offensichtlicher ihre politische und militärische Abhängigkeit von der westlichen Großmacht wurde, desto lauter wurden Zweifel an ihrem Demokratie- und Souveränitätsverständnis geäußert: Viele von uns sahen in ihr nur noch einen „Erfüllungsgehilfen“ der Amerikaner. Die umstrittene Haltung der sozial-liberalen Regierung im Vietnam-Konflikt beschäftigte mich noch in meinen beiden ersten Pariser Jahren, als Studierenden- und Forschendenvertreter im Deutschen Haus der „Cité Universitaire“. Am 22. Januar 1973, nur wenige Tage vor der Beendigung der amerikanischen Militäroperationen durch das Pariser Abkommen vom 27. Januar, übergab ich in der Botschaft der Bundesrepublik einen „Offenen Brief“ der Vollversammlung der Residenten unseres Hauses für Bundeskanzler Brandt. Dieser befand sich auf Einladung des französischen Präsidenten Georges Pompidou gerade auf Staatsbesuch in Frankreich, zur Feier des 10. Jahrestages der Unterzeichnung des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages (1963). „Der Mythos Brandt ist tot“: Unser Brief enthielt einen von der französischen und deutschen Tagespresse beachteten Protest gegen das Schweigen des Friedensnobelpreisträgers und NS-Widerstandskämpfers über die kürzliche Wiederaufnahme der amerikanischen Bombenangriffe auf Nordvietnam und ihre verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung.[Anm. 10]
0.5.2.Denkmodelle und Reformpotenziale der 68er-Bewegung
Mit dem Niedergang von Studierendenbewegung und APO – ausgelöst durch den noch in der zweiten Hälfte des Jahres 1968 beginnenden Zerfall des SDS – erfolgte vielerorts eine Selbstauflösung der Republikanischen Clubs.
Teile der 68er-Aktivisten schlossen sich den K-Gruppen an: ideologisch gespaltenen, rivalisierenden Kleinstparteien mit dem Selbstverständnis von kommunistischen Kaderorganisationen überwiegend maoistischen Zuschnitts – unter dem Eindruck der 1966 angelaufenen Kulturrevolution in der Volksrepublik China. Da das Scheitern der APO als antikapitalistische Protestbewegung nicht zuletzt auf den fehlenden Schulterschluss mit der Arbeiterklasse zurückgeführt wurde, ging es der im Dezember 1968 gegründeten Kommunistischen Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML) sowie später entstandenen ähnlich dogmatischen Formationen darum, die Arbeiterschaft als revolutionäres Subjekt wiederzuentdecken und zu mobilisieren. „Rein in die Betriebe“! Ich staunte nicht schlecht, als Kommilitonen sich 1969 aus dem Hörsaal verabschiedeten, um in die Fabriken abzuwandern. Als „Lohnarbeiter“ wollten sie am Fließband den fordistischen Produktionsprozess mit „Ausbeutung“ und „Entfremdung“ hautnah erfahren, die Positionen des Klassenkampfes propagieren sowie die proletarische Revolution unter Führung ihrer marxistisch-leninistischen Avantgarde in die Wege leiten. Im Widerspruch zum emanzipatorischen Anspruch von Studierendenbewegung und APO setzte nun „eine Fetischisierung der politischen Basisarbeit und eine Formalisierung der Organisationsdebatte“ ein, mit rigiden Vorgaben für Parteiaufbau und politische Praxis.[Anm. 11]
Mit den Spontis überlebte auch eine antiautoritäre Tendenz der 1960er Jahre, die sich an den Theorien von Rosa Luxemburg orientierte. Wenn die „Spontaneität der Massen“ hier zum revolutionären Element der Geschichte hochstilisiert wurde, so jedoch weniger unter Rückgriff auf die klassische Agitation im Betrieb, auf Theorieschulungen und Parteiaufbau als auf fantasievolle spontane und öffentlichkeitswirksame Aktionen. So galt insbesondere das Straßentheater als probates Mittel, ein „linkes Gegenmilieu“ zu schaffen.
Die Zersplitterung in Kleinstparteien links von der SPD war aber nur eine der Folgen des Zerfallsprozesses der 68er-Bewegung. Eine weitaus größere Zahl ihrer Aktivisten schloss sich etablierten Parlamentsparteien an, um „von innen“ auf sie einzuwirken und auf Reformen zu dringen. Gewinner des „Marschs durch die Institutionen“ (Rudi Dutschke) waren vor allem die Sozialdemokraten. In ihrem Vorsitzenden Willy Brandt besaßen sie eine attraktive Leitfigur. Ihm haftete keine NS-Vergangenheit an wie Bundeskanzler Kiesinger, da er während des Zweiten Weltkrieges in der Emigration Widerstand gegen das NS-Regime leistete. Nach 1945 hatte sich Brandt als Regierender Bürgermeister von Westberlin (1957–1966), Außenminister und Vizekanzler der Großen Koalition (1966–69) als Reform- und Entspannungspolitiker profiliert. Nach den erfolgreichen Bundestagswahlen von 1969 sollte er als Kanzler einer sozialliberalen Regierungskoalition in der Innenpolitik („Mehr Demokratie wagen“) wie in der Außen-, vor allem Ostpolitik („Wandel durch Annäherung“) nachhaltige Akzente setzen. Der Hoffnungsträger der SPD war uns Studierenden vor allem von dem Schriftsteller und künftigen Literatur-Nobelpreisträger (1999) Günter Grass vermittelt worden. Als engagierter Intellektueller hatte dieser auf seiner Wahlkampf-Tour durch die Bundesrepublik in einem VW-Campingbus auch in Mainz Halt gemacht. Grass empfahl die SPD als „einzig wählbare Alternative“. Er appellierte dafür, Politik für junge Menschen vermittelbar zu gestalten unter konsequenter Berücksichtigung der Anliegen der Protestbewegung: Es gelte Tabuthemen wie die Nazi-Vergangenheit politischer Größen, die Frage der deutschen Einheit oder die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs (§ 218 StGB) entschieden anzugehen. Zwei Jahre später, am 5. Juli 1971, wurde ich als Studienreferendar Zeuge von Brandts ungebrochener Popularität, als er in Begleitung des französischen Staatspräsidenten Georges Pompidou mit einem Hubschrauber direkt auf einer Rheinaue gegenüber dem Kurfürstlichen Schloss, unweit meines Gymnasiums, landete und von einer jubelnden Menge empfangen wurde. Darunter waren Lehrer und Schüler aus der französischen Partnerstadt Dijon, die im Rahmen eines Austauschprogramms in Mainz weilten. Brandt und Pompidou waren „dienstlich unterwegs“: Bei der anschließenden gemeinsamen Schifffahrt mit der „Loreley“ nach Koblenz nahmen sie ihre deutsch-französischen Konsultationsgespräche auf – Zusammentreffen auf höchster Ebene, wie sie der Deutsch-Französische Freundschaftsvertrag von 1963 zweimal jährlich vorschrieb.
Der frühe Ruf der Studierenden nach Demokratisierung nicht nur in Universitäten und Schulen, sondern in allen Bereichen von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft beinhaltete natürlich auch Denkanstöße für die Arbeitswelt. So wurde im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) schon bald über eine Reform von Unternehmens- und Betriebsverfassung und damit den Ausbau der Arbeitnehmermitbestimmung nachgedacht. Nach Brandts programmatischer Erklärung von 1969, „mehr Demokratie zu wagen“, legte seine Koalitionsregierung aus SPD und FDP im Januar 1971 einen Gesetzentwurf zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes vor, der am 10. November gegen den Widerstand des Unternehmerlagers mit einigen Änderungen verabschiedet wurde, so dass das Gesetz am 18. Januar 1972 in Kraft treten konnte. Die Initiative der Regierung war auch eine Antwort auf die Septemberstreiks von 1969, als es im Ruhrgebiet, im Saarland und in anderen Industriezonen der Bundesrepublik zu „wilden Streiks“ gekommen war. Diese von den dogmatischen Strömungen der Neuen Linken als „proletarische Wende“ der Protestbewegung bezeichnete Entwicklung widerlegte in ihren Augen die These von der „Systemintegration“ der bundesdeutschen Arbeiterschaft, die sich, im Gegensatz zu den Lohnabhängigen im Mai 1968 in Frankreich, jeder Solidarität mit den Studierenden versagt habe. Für die K-Gruppen hatten die Septemberstreiks Signalwirkung: Sie legitimierten ihre Strategie der Betriebsarbeit und der „proletarischen“ Umerziehung ihrer (zumeist studentischen) Kader.
Wenn ich diesen Formationen der Neuen Linken politisch wenig abgewinnen konnte, so, weil mir ihre Dogmatik nur teilweise vertraut, d. h. mein marxistischer Bewusstseinsstand, wie man damals sagte, nicht ausreichend entwickelt war. Ich galt bestenfalls als „Herzenssozialist … wie Sartre“ – ein Vergleich, fand ich, der mich adelte. Gewiss, die Analyse von Staat und Gesellschaft war auch bei mir durch die in den 1960er Jahren unausweichliche Beschäftigung mit Marx und dem Marxismus beeinflusst worden: Neue neomarxistische Ansätze für eine Kapitalismuskritik, vor allem die „Kritische Theorie“ der Frankfurter Schule (Horkheimer, Adorno, Marcuse), dominierten den politischen Diskurs an den Hochschulen. Basisgruppen boten Schulungen in Marxistischer Theorie, beginnend mit seiner Kritik der Politischen Ökonomie („Das Kapital“) an. Einflüsse, die aber nicht ausreichten, um mich von der Notwendigkeit eines parteipolitischen Engagements zu überzeugen. Die durch meine bürgerlich-katholische Sozialisation geförderte Aversion gegen das Modell des „real existierenden Sozialismus“ in der DDR und den anderen Ländern des sowjetischen Machtbereichs, wie es die 1968 gegründete Deutsche Kommunistische Partei (DKP) auch für die Bundesrepublik reklamierte, war durch die Protestbewegungen noch verstärkt worden: Es widersprach dem Demokratieverständnis und den emanzipatorischen Zielsetzungen eines großen Teiles ihrer Aktivisten.
Durch Geschehnisse wie den Bau der Berliner Mauer (13. August 1961) oder zuletzt die gewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings (20. August 1968) waren die marxistisch-leninistischen Systeme zumindest bei den antiautoritär geprägten 68ern in Verruf geraten. Ihre Sympathien galten hingegen den Reformkommunisten in Ost und West. Ihre Existenz signalisierte einen Zug der Zeit: Allenthalben wurden etablierte Dogmen infragegestellt und „Brücken“ zwischen den Ideologien geschlagen. So knüpften die tschechischen Reformer um Alexander Dubček mit ihrem Sozialismus mit menschlichem Antlitz eher an traditionelle sozialdemokratische als an marxistisch-leninistische Denkmuster an und setzten auf die Anerkennung der bürgerlichen Grundrechte. En vogue war ebenfalls das Interesse an Jugoslawien. Der dort nach dem Bruch mit der Sowjetunion (1953) eingeschlagene Sonderweg der regierenden Kommunisten unter Tito galt als Reformsozialismus, mit der Arbeiter-Selbstverwaltung als prägendem Merkmal. Eben dieses Konzept war unter dem Begriff „Autogestion“ soeben durch die Massenstreiks, Fabrikbesetzungen und Selbstverwaltungsexperimente des Mai ‘68 in Frankreich populär geworden. Die nichtkommunistische französische Linke versprach sich von der Idee Denkanstöße für ihre ideologische und politische Erneuerung, vor allem für die Entwicklung eines wirtschaftsdemokratischen Gegenmodells – nicht zuletzt zur deutschen Mitbestimmung.

- Empfang durch die Stadt Zagreb im Rahmen der vom Autor organisierten Zagreb-Reise von Mainzer Studierenden im Februar/März 1971. Von links nach rechts: der Autor (Reiseleiter), Dolmetscher Zvonimir Misanec (Mainz), Bürgermeister Knežević, Oberbürgermeister Kolar, ein Mitglied des Stadtrates; im Hintergrund das Porträt des jugoslawischen Marschalls Tito.[Bild: Privatarchiv des Autors, Fotograf unbekannt]
Interesse an einem Einblick in das jugoslawische Selbstverwaltungsexperiment bestand aber auch an deutschen Universitäten. Zumal in Mainz, das eine enge Städtepartnerschaft mit Zagreb, der Hauptstadt der Teilrepublik Kroatien unterhielt. Im Rahmen meines Tutorates im Studierendenwohnheim Mainzer Kolleg auf dem Campus der Universität bot ich eine Studienreise nach Zagreb an, an der 40 Studierende aller Fakultäten teilnahmen (24. Februar – 4. März 1971) – großzügig gefördert aus Bundes-, Landes- und städtischen Mitteln. Oberbürgermeister Josip Kolar Matek höchstpersönlich erklärte uns Idee und Funktionsweise des jugoslawischen Selbstverwaltungssozialismus und war bemüht, uns in diesen Tagen realistische Einblicke in Verwaltung und Arbeitswelt zu verschaffen. An der Arbeiteruniversität trafen wir auf dialogbereite Dozenten. Wenn die Studienreise letztendlich dennoch wenig werbewirksam für das „jugoslawische Modell“ war, so, weil sie in die Zeit des kroatischen Frühlings fiel: 1970/1971 war Zagreb Zentrum des politischen Widerstandes gegen die Politik der Zentralregierung des föderativen Vielvölkerstaates im serbischen Belgrad. Da die Demonstrationen vor allem von Studierenden getragen wurden, lag es nahe, dass wir uns ihre Hauptforderungen – Bürgerrechte für kroatische Bürger, besonders das Recht auf eine eigene kroatische Nationalität – von ihnen selbst erklären ließen, abseits unseres offiziellen Besuchsprogramms. Dazu kam es zu mitternächtlicher Stunde in einer verrauchten Studentenkneipe: Unser Gesprächspartner war der 24-jährige Ivan Zvonimir Čičak, einer der führenden Köpfe der Bewegung. Er sollte sich nach dem Zerfall Jugoslawiens und der Unabhängigkeitserklärung Kroatiens (1991) als patriotischer Politiker, Journalist und Menschenrechtsaktivist einen Namen machen.[Anm. 12]
Die Infragestellung der politischen Verfasstheit des Vielvölkerstaates musste auch sein gesellschaftliches Selbstverwaltungsmodell belasten, wie ich gleich zu Beginn meiner Pariser Jahre feststellen konnte. Als Mitglied einer Forschergruppe an der Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) unterhielt ich in den 1970er Jahren Kontakte zur Gruppe „Praxis“ um Rudi Supek, einer Gruppe systemkritischer jugoslawischer Philosophen und Sozialwissenschaftler. Sie verwarf bereits seit einem Jahrzehnt die Orthodoxie des jugoslawischen Kommunismus. Ihm eine stalinistische, mit den Ideen von Karl Marx unvereinbare Tendenz unterstellend, hielt sie bei der Einleitung gesellschaftlicher Reformprozesse die Rückbesinnung auf dessen frühe Werke für unerlässlich – einem undogmatischen, humanistischen und schöpferischen Marxismus das Wort redend.
In Zeiten, in denen Orthodoxien infragegestellt, Dogmen aufgeweicht und ideologische Gräben überbrückt wurden, kam auch das konservative Studierendenmilieu in Bewegung. In der katholischen "Unitas-Willigis" in Mainz verfolgten wir mit Spannung den international stark beachteten christlich-marxistischen Dialog des kommunistischen Philosophie-Professors Roger Garaudy aus Frankreich (Universität Poitiers) mit katholischen Intellektuellen über die Gemeinsamkeiten von Religion und Ideologie.
Die Theoriedebatten der 1960er Jahre erwiesen sich als geistige Herausforderung, die das staatsbürgerliche Bewusstsein unserer Generation reifen und sie zum Motor von Wandlungsprozessen werden ließ. War es doch ihr Verdienst, dass die Zivilgesellschaft erstmals in der Geschichte der jungen Bundesrepublik als „politischer Akteur“ auf den Plan trat und Impulse für die Demokratisierung und Humanisierung von Staat und Gesellschaft freisetzte. Einflüsse und Erfahrungen, die sich auf meine persönliche Entwicklung auswirkten. Von der katholischen Soziallehre geprägt, lag es nahe, mich den neuen sozialen Bewegungen anzunähern: mit ihren offenen, wenig reglementierten Formen der Bürgermobilisierung zu gemeinwohlorientierten Zwecken oder zu Gunsten gesellschaftlich benachteiligter Gruppen. Wenn der für meine Politisierung nachhaltigste Zug der Protestbewegung ihre internationale Ausprägung und demonstrative Solidarität mit den Völkern der Dritten Welt war, so gewiss nicht zuletzt infolge meiner interkulturellen Sensibilisierung von Jugend auf: Die in der Familie stark präsente konfessionelle Presse mit ihren weltweiten Berichten aus den Missionen sowie über die Arbeit der christlichen Hilfswerke hatten bei mir früh Interesse und Verständnis für fremde Kulturen geweckt.
0.6.3.3. Neue soziale Bewegungen als politisches Aktionsfeld der Zivilgesellschaft: „Dritte-Welt“-Solidarität und Ausländerintegration
Solidarität galt nicht nur Völkern, die noch Dekolonisierungskriege führten (z. B. Algerien, Angola, Mozambique) oder Opfer von neokolonialen Politiken wurden (Lateinamerika, Kongo, Südvietnam). Sie konnte auch aus primär humanitären Gründen erfolgen, wie 1968 bei meiner ersten Beteiligung an einer Dritte-Welt-Aktion anlässlich des Bürgerkrieges im afrikanischen Vielvölkerstaat Nigeria (1967–1970). Er war ausgebrochen, nachdem sich die erdölreiche Provinz Biafra für selbständig erklärt und die Sezession gefordert hatte.[Anm. 13] Die unsäglichen Folgen des Krieges für die Zivilbevölkerung, vor allem die Hungerkatastrophe im umkämpften Gebiet, sorgten für weltweite Anteilnahme. Neben den kirchlichen und staatlichen Hilfsorganisationen engagierten sich Bürgerinitiativen: In Deutschland entstand ein regelrechtes Netzwerk von Biafra-Komitees. Nie zuvor hatte ein internationaler Konflikt – auch nicht der Vietnamkrieg – ein solches Maß an Erschütterung und Betroffenheit in der Bevölkerung ausgelöst wie dieser Krieg. Die Erklärung: Erstmals kam es zum massiven Einsatz neuer medialer Techniken bei der Verbreitung von Bild- und Tonmaterial aus einem Kriegsgebiet. Alarmiert durch die Augenzeugenberichte einer Reporterin der Wochenzeitung Die Zeit, begründete unsere Studentenverbindung „Unitas-Willigis“ 1968 ein Biafra-Komitee für Mainz. Es war Teil eines bundesweiten informellen Netzwerkes, das unabhängig von den etablierten, auf staatliche Zusammenarbeit angewiesenen Hilfsorganisationen operierte. Als „humanitäre Internationale“ verfügte es über eine eigene Logistik, um gezielter und wirksamer zu helfen. Die Öffentlichkeitsarbeit des Netzes zielte darauf ab, die genozidiäre Tendenz der Repression gegen die Igbos, Biafras dominante Volksgruppe, aufzudecken. An der Mainzer Universität organisierten wir eine stark beachtete „Biafra-Informationswoche“[Anm. 14] und beteiligten uns an der bundesweiten Protestkundgebung der Biafra-Komitees gegen den englischen Premierminister Harold Wilson (Labour Party) während dessen Bonn-Besuchs im Februar 1969. Großbritannien unterstützte – wie die Sowjetunion und die USA – die Zentralregierung Nigerias, seine frühere Kolonie, der 1960 die Unabhängigkeit zugestanden worden war. Der zögerlichen, auf „Nichteinmischung“ bedachten Haltung der UNO sowie der meisten europäischen Länder begegneten die Biafra-Komitees mit der Forderung nach sofortiger Entsendung von unabhängigen internationalen Beobachtern, nach Einstellung der Waffenlieferungen an die Zentralregierung sowie nach Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung und Öffnung der eingeschlossenen Provinz. Als Formen zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation konnten sich diese Komitees zum Teil dauerhaft etablieren. So ging aus der Aktion Biafra-Hilfe 1970 die Gesellschaft für bedrohte Völker hervor. Weltweite Bedeutung erlangte „Ärzte ohne Grenzen“ („Médecins sans Frontières“), die 1971 im Anschluss an ihren humanitären Biafra-Einsatz von französischen Ärzten gegründete Organisation für medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten. Das Biafra-Engagement der „Unitas-Willigis“ signalisierte, dass es für katholische Hochschulgemeinden durchaus Anlässe geben konnte, die internationale Ausrichtung der Proteste der 1960er Jahre begrenzt mitzutragen. Mitglieder des Altherrenverbands der „Unitas“ wie Heinrich Tenhumberg – von 1969 bis 1979 Bischof von Münster – kritisierten gar die Politik der Nichteinmischung im Nigeria/Biafra-Konflikt. Teilnehmer am II. Vatikanischen Konzil (1962–1965), war er früh Verfechter eines „charismatischen Aufbruchs“ der Kirche. Seine Anregung wurde von der katholischen Befreiungstheologie (Gustavo Gutiérrez, 1971) aufgegriffen, die von Lateinamerika aus weltweit in die Ökumene und besonders in den sozialkritischen Protestantismus hineinwirken sollte. Dieser war in der Bundesrepublik stark ausgeprägt. „Internationale Christen“ wie der Theologe und Schriftsteller Helmut Gollwitzer beeinflussten nicht zuletzt die 68er: In Mainz kamen zahlreiche Aktivisten des lokalen SDS aus der Evangelischen Studierendengemeinde.
Unbestreitbar war es der internationalen Ausrichtung der Protestbewegung zu danken, dass in der Bundesrepublik die öffentliche Aufmerksamkeit für Dekolonisationskonflikte und Menschenrechtsverletzungen in Dritte-Welt-Ländern zunahm. Gleichzeitig begann man aber auch, die Diskriminierung von Ausländern im eigenen Lande zu diskutieren und über Mittel und Wege einer besseren Integration nachzudenken. Damit rückten für mich die ausländischen Studierenden in den Fokus. Ihrer Situation widmete ich mich 1970/71, parallel zu meiner Lehrtätigkeit als Studienassessor „zur Anstellung“ am Mainzer Schloss-Gymnasium. Während meines Tutorates am Mainzer Kolleg auf dem Universitätscampus[Anm. 15] richtete ich eine „Projektgruppe Gaststudent“ ein. Wir wiesen einen ausländerfeindlichen Trend auf dem lokalen Wohnungsmarkt nach: Fast die Hälfte aller Zimmerangebote beim Studentenwerk der Universität trugen den Vermerk „kein Ausländer“ oder gar „kein Farbiger“. Im Hinblick auf die Identifizierung und Lösung der Probleme der Gaststudenten setzten wir auf ihren Eigenbeitrag: ihre Selbstorganisation und Bereitschaft zur Wahl einer ausländischen Studierendenvertretung. Die nationalen Studierendenverbände in Mainz – allen voran die aktivste von allen, die Organisation der iranischen Studierenden, erbitterter Gegner des Shah-Regimes in Teheran – begrüßten unsere Initiative. So wurde der 17. Dezember 1970 zu einem historischen Datum in der Universitätsgeschichte: Zum ersten Mal trat eine Vollversammlung der ausländischen Studierenden zusammen. Es blieb ihr vorbehalten, die Wahl einer eigenen Interessenvertretung vorzubereiten und in Zusammenarbeit mit dem ASTA Vorschläge für eine bessere soziale Integration der ausländischen Studierenden sowie eine Reform der Ausländergesetzgebung zu erarbeiten.[Anm. 16]
Nach meinem Wegzug aus der Bundesrepublik im September 1971, um mit Antritt einer Assistentenstelle in Frankreich die wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen, engagierte ich mich als Resident der Pariser „Cité universitaire“ (CIUP) in den Jahren 1972 bis 1975 weiterhin für studentische Mitspracherechte. Als gewählter Vertreter der deutschen und ausländischen Studierenden und Forschenden im Wohnheim „Deutsches Haus“ („Maison de l’Allemagne“) setzte ich mich für den Erhalt ihrer am deutschen Mitbestimmungsmodell orientierten, aber von der französischen Zentralverwaltung infragegestellen Rechte bei der Leitung und Verwaltung des Hauses ein.[Anm. 17] Darüber hinaus war die Durchsetzung eines Minimums an Informations- und Anhörungsrechten in den meisten anderen Häusern des 5 000 Residenten aus 116 Ländern zählenden Pariser Vorzeige-Campus dringlich. Rechte, die den unter französischer Verwaltungskontrolle stehenden Wohnheimen mit ihren vielen Dritte-Welt-Residenten noch verweigert wurde. Obwohl im Mai ‘68 angemahnt, sollten sich „partizipative“ Praktiken, wie sie zum Beispiel im deutschsprachigen oder skandinavischen Hochschulraum Usus waren, hier erst jetzt entwickeln – unter dem Druck von Studierenden und Forschenden. Im Verlaufe unserer Konflikte mit den Leitungen der Häuser setzten wir als Delegierte der „Coordination des Comités des Résidents“ dank effizienter Formen der Selbstorganisation unsere Forderungen durch: Neue Statuten garantierten seitdem den Residenten Vertretung und Mitsprache auf allen Leitungs- und Verwaltungsebenen des Campus.
Die Erfahrungen in der Pariser „Cité universitaire“ waren richtungsweisend für meine weitere persönliche Entwicklung. Als Hochschullehrer und Forscher beschäftigt mich bis heute die Frage, inwieweit direkt-demokratische partizipative Ansätze die oft nur formal funktionierende repräsentative Demokratie ergänzen und dynamisieren können. Mit Bezug nicht nur auf Arbeitnehmermitbestimmung und industrielle Demokratie,[Anm. 18] sondern auch auf die universitäre Demokratie: fokussiert auf die Frage nach der Rolle der Studierenden als zivilgesellschaftliche Akteure in den europäischen Hochschulbeziehungen.[Anm. 19] Ausländer- und Dritte-Welt-Engagement blieben bekanntlich nicht den Universitäten vorbehalten. In der Bundesrepublik griffen solche Initiativen schon in der Endphase der 68er-Bewegung vom Campus auf die Zivilgesellschaft über. Sie verbanden sich mit tausenden sozial- und umweltpolitisch engagierter Bürgerinitiativen zu neuen sozialen Bewegungen.
0.7.4. Ausblick: Zu den Impulsen der 68er-Bewegung für die Entwicklung der Zivilgesellschaft
Der 1967 von SDS-Studentenführer Rudi Dutschke in Anlehnung an Mao Zedong geforderte „Lange Marsch durch die Institutionen“ – natürlich gemeint als „lang anhaltender Volkskrieg“ gegen die Institutionen der bürgerlichen Demokratie – hat in der Bundesrepublik definitiv nicht stattgefunden. Nicht zuletzt die K-Gruppen-Generation, als dogmatische Komponente der Neuen Linken, erlag weitgehend der Integrationskraft demokratischer Werte. Die 68er hinterfragten die Interpretation, die die Eliten der Nachkriegszeit diesen Werten beimaßen. Die Neubesinnung auf das Wesen der westlichen Demokratie – unter anderem angestoßen durch Anti-Atomkraft-, Friedens- und Frauenbewegung – wurde seit den 1970er Jahren durch weitere neue soziale Bewegungen fortgeführt. Mit ihnen trat die Zivilgesellschaft als politischer Akteur auf den Plan. Ihr Einfluss auf das etablierte Parteiensystem wuchs schlagartig, nachdem sich eine Vielzahl von grünen, bunten und alternativen Listen, die auf lokaler und regionaler Ebene bereits Wahlerfolge gezeitigt hatten, zur Partei „Die Grünen“ zusammengeschlossen hatten (12./13. Januar 1980). Diese Partei „neuen Typs“ trat mit dem Anspruch an, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung ökologischen Prämissen zu unterwerfen und für alternative, Individuum und Kollektiv gleichermaßen bereichernde Lebensformen zu sensibilisieren. Die Übernahme von Regierungsmitverantwortung auf Länder- und bald auch Bundesebene signalisierte den realpolitischen Wandlungsprozess der Grünen: die Abkehr vom anfänglichen Selbstverständnis als basisorientierter parlamentarischer Oppositionspartei.[Anm. 20]
Spannt man den Bogen von den Protesten der 1960er Jahre bis zu den Massenmobilisierungen unserer Tage im Kontext von Krisen und Transformationsprozessen, so sind die Szenarien nicht mehr deckungsgleich. Gewiss, es handelt sich weiterhin vielfach um medienwirksame Straßenproteste. Im Hinblick auf dringliche Lösungen im Allgemeininteresse und eine bürgernähere Politik ist der Druck „von unten“ auf die Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gewachsen. Da in Zeiten von Globalisierung und europäischer Integration Protestbewegungen im zunehmenden Maße transnational agieren: Dank sozialer Netzwerke ermöglicht die Digitalisierung eine grenzüberschreitende Planung und Koordinierung der Aktionen sowie ein höheres Maß an Reaktivität als in den Jahren der 68er-Bewegung.
Nachweise
Verfasser: Otmar Seul
Weiterführende Literatur:
- Kißener, Michael: Auf dem Weg zur demokratischen "Massenuniversität". Die JGU in den 1960er-Jahren, in: Krausch, Georg (Hrsg.): 75 Jahre Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Universität in der demokratischen Gesellschaft. Regensburg 2021, S. 74-89.
Erstellt am: 27.04.2022
Anmerkungen:
- Axel Redmer: Im Schatten der Revolte. Die 68er-Zeit und ihre Vorgeschichte in der Provinz, Sonderband 82 des Vereins für Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld, Birkenfeld 2018, 360 Seiten. Zurück
- 1943 als erstes von acht Kindern eines Lehrerehepaares in Trier geboren, verbrachte ich meine ersten Lebensjahre im Umfeld der Römer- und Bischofsstadt zwischen Mosel und Eifel. 1950 zog die Familie nach Birkenfeld, wo mein Vater eine Studienassessorenstelle am Neusprachlichen Gymnasium angetreten hatte. Zurück
- Stadtfacette Idar-Oberstein, Ausgabe 43/2018. URL: https://ol.wittich.de/titel/700/ausgabe/43/2018/artikel/00000000000008432509-OL-700-2018-43-43-0 (Abruf 23. November 2021). Zurück
- Werner Bohrer: Heimatschutztruppler aus den Kreisen Birkenfeld, Kreuznach und Simmern, in: Birkenfelder Zeitung vom 24. Oktober 1967. Zurück
- David Bebnowski (Hg.): Generation und Geltung: Von den „45ern“ zur „Generation Praktikum“ – übersehene und etablierte Generationen im Vergleich, Göttingen 2012, S. 67, 69. Hervorgegangen aus den „gesellschaftlichen Umruchprozessen der 50er Jahre infolge des Wohlstands, der den Lebensstandard der Arbeiter erheblich anhebt, (…) empfinden [die ‚Halbstarken‘] den Ausstieg aus dem proletarischen Milieu als Befreiung (…). Die jungen ‚Halbstarken‘ lebten und konsumierten für den Augenblick, bereiteten sich nicht mehr asketisch im Arbeiterbildungswesen der Sozialdemokraten auf ein fernes sozialistisches Endziel vor“; https://www.jstor.org/stable/j.ctv1fxf3z.5?seq=1#metadata_info_tab_contents (Abruf 28. Dezember 2021). Zurück
- Un groupe d’étudiants de Mayence à Dijon, Zeitungsinterview in: Les Dépêches vom 21. Februar 1968, S. IV. Zurück
- Christin Sager: Das Ende der kindlichen Unschuld. Die Sexualerziehung der 68er-Bewegung, in: Meike Sophia Baader (Hg.): „Seid realistisch, verlangt das Unmögliche!“ Wie 1968 die Pädagogik bewegte, Weinheim/ Basel, 4. Auflage 2008, S. 56–68; Reinhard Wolff: Antiautoritäre Erziehung; in: Dieter Kreft/ Ingrid Mielenz (Hg.): Wörterbuch „Soziale Arbeit“. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Weinheim/ München, 6. Auflage 2008, S. 84 f.; Gerhard Bott: Erziehung zum Ungehorsam. Kinderläden berichten aus der Praxis. Frankfurt a. M. 1970 f., S. 100; Johannes Claßen (Hg.): Antiautoritäre Erziehung in der wissenschaftlichen Diskussion. Heidelberg 1973, S. 101 f. Zurück
- Dieses exekutive und mit der Außenvertretung betraute Organ der verfassten Studierendenschaft in Mainz hatte gerade mit der Forderung an Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger (CDU) „die Bundesrepublik als Rechtsstaat wieder herzustellen“ (Vorsitzender Jürgen Büscher) für Schlagzeilen gesorgt. Zurück
- Der Militärhistoriker Sönke Neitzel in: Der Spiegel Nr. 44, 24. Oktober 2020, S. 40. Zurück
- „[…] Que le gouvernement allemand ait si peu de souvenir devant ce qui s’est passé et si peu de réaction devant ce qui se passe en ce nouvel Oradour nous consterne et nous fait honte“ – zitiert nach Le Monde vom 24. Jannuar 1973; vgl. auch u. a. Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Frankfurter Rundschau vom 24. Januar 1973. Während der Übergabe des „Offenen Briefes“ protestierten auf dem Botschaftsgelände 30 deutsche Studierende mit Transparenten gegen die entgegenkommende Haltung der Bundesregierung gegenüber den USA. Infolge des schnellen Einschreitens der französischen Bereitschaftspolizei war ihr Protest nur von kurzer Dauer. 15 Demonstranten wurden vorübergehend festgenommen, doch auf Ersuchen der Deutschen Botschaft noch am Abend desselben Tages wieder freigelassen. Willy Brandts Amerikafreundlichkeit war hinlänglich bekannt. Sie ist möglicherweise auf eine Geheimdiensttätigkeit in der Nachkriegszeit zurückzuführen: Wie erst unlängst bekannt wurde, soll er von 1948 bis 1952 Informant des US-Militärgeheimdienstes CIC gewesen sein, dem er gegen Bezahlung Informationen über die politische und wirtschaftliche Entwicklung in der DDR lieferte; siehe Klaus Wiegrefe: Informant „O–35–VIII“: Willy Brandt war für den US-Geheimdienst aktiv, in: Der Spiegel, 17. Dezember 2021, spiegel.de (Abruf 18. Dezember 2021) sowie Die Zeit, 18. Dezember 2021: Willy Brandt war Informant für US–Militärgeheimdienst (Abruf 18. Dezember 2021). Zurück
- Klaus Farin: Die Wiederentdeckung der „Arbeiterklasse“– K-Gruppen, Dossier Jugendkulturen, Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn, 25. Februar 2010. URL: https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/jugendkulturen-in-deutschland/36191/wieder-entdeckung-der-arbeiterklasser-k-Gruppen/ (Abruf 19. Dezember 2021). Zurück
- Nach unserer Begegnung standen ihm allerdings zunächst einmal harte Zeiten bevor: Nach der baldigen Niederschlagung des kroatischen Frühlings wurde er noch im Dezember 1971 festgenommen und wegen „konterrevolutionärer“ Tätigkeit zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Zurück
- Es handelte sich um die bis dahin kriegerischste Auseinandersetzung in Afrika nach dem Ende des Kolonialismus. Die Rivalitäten zwischen den muslimischen Haussa und Fulani im Norden und den separatistischen christlichen Ibos im Süden um die Vormachtstellung im Staat wurden von den europäischen Medien mitunter als „Religionskrieg“ apostrophiert. Realistischer war es, die Originalität dieses Krieges mit Blick auf die Allianzen der beiden Seiten zu begreifen. In Zeiten des anhaltenden Ost-West-Konflikts war der Konflikt alles andere als ein typischer Stellvertreterkrieg, da England und die Sowjetunion die Regierungsseite, Frankreich, Portugal und Israel hingegen die abtrünnige Provinz Biafra unterstützten. Nicht nur die europäischen Regierungen, sondern auch die bundesdeutsche Protestbewegung blieb in der Biafra-Frage gespalten. Der SDS lehnte Solidaritätserklärungen und Hilfsaktionen zugunsten der von einer Hungerkatastrophe bedrohten Provinz aus ideologischen Gründen ab, da es sich bei diesem Konflikt um „einen zu vernachlässigenden Nebenwiderspruch“ handele – mit dem Hinweis auf die sozialistischen Schirmherren Nigerias in London und Moskau; vgl. https://www.gfbv.de/de/news/zum-ausbruch-des-biafra-krieges-vor-40-jahren-3521 (Abruf 27. November 2021). Zurück
- Siehe Mainzer Allgemeine Zeitung vom 6., 9., 10. und 13. Dezember 1969. Zurück
- Das aus dem Leibniz-Haus und dem Geschwister-Scholl-Haus bestehende Studierendenheim sollte „in besonderem Maße mit dazu beitragen, die Ziele und Aufgaben der Universität zu verwirklichen“ (Johannes Gutenberg-Universität, Vorlesungsverzeichnis WS 1970/71, S. 30). Die von den 140 Heimbewohnern direkt gewählten Tutor:innen waren Teil der Studierenden-Selbstverwaltung. In erster Linie zuständig für ein breites Angebot an allgemeinbildenden und kulturellen Veranstaltungen, wurden sie aber auch in die Lösung von Integrationsproblemen einbezogen. Zurück
- Vgl. meinen Bericht in Jogu, Mainzer Studentenzeitung, 1971, Nr. 1, S. 37 f. Zurück
- Im Frühsommer 1973 führte eine vom Träger des Hauses (DAAD) und seinem Verwaltungsrat beschlossene Mieterhöhung zu einem Konflikt mit den Heimbewohnern. Diese machten eine Missachtung ihrer im Hausstatut vereinbarten Mitbestimmungsrechte geltend. Die Weigerung, die Mieterhöhung rückgängig zu machen, wurde von ihnen mit einem Mietstreik beantwortet. Zudem lehnten sie die Berufung eines neuen Direktors ab, der sich nicht ihrer Vollversammlung vorstellen wollte. Der Konflikt gab der französischen Zentralverwaltung Anlass, die vorübergehende Schließung des Hauses durchzusetzen und seine Wiedereröffnung an die Bedingung eines neuen, mit ihren Richtlinien vereinbaren Hausstatutes ohne Mitbestimmung zu knüpfen. Der Konflikt fand mediale Beachtung; vgl. u. a. Le Monde vom 4. August 1973. Das bundesdeutsche Erste Deutsche Fernsehen berichtete am 30. Juli 1973 in der Tagesschau über die Auseinandersetzung (Beitrag 06, Team Beam-NDR, Media GmbH, Mitschnittservice). Als Initiator und Koordinator der Residentenkomitees („Coordination des Comités des Residents“) kam ich 1975 als Gegenpart des Generalbevollmächtigten der Cité, Pierre Marthelot, in Jean-Luc Magnerons TV-Dokumentation „Une Cité pas comme les autres“ (FR 3-France Régions 3) zu Wort. Zu Natur, Verlauf und Folgen der Konflikte im „Deutschen Haus“, siehe vor allem Joachim Umlauf: Düsseldorf – Paris … wie Heinrich-Heine-Universität und Heinrich-Heine-Haus zu ihrem Namen kamen, in: Passerelles et passeurs, PU Sorbonne Nouvelle, Paris 2002, S. 387 f., 393 f. Von 1996 bis 2000 Leiter des Hauses, liefert Umlauf die wohl sachlichste Nachbetrachtung zur Schließung der Maison de l’Allemagne im Sommer 1973 und den Bedingungen ihrer Wiedereröffnung als Maison Heinrich Heine im Herbst desselben Jahres. In der „in vielem traditionell strukturierte(n) (…), reformbedürftig und altem Denken verhaftete(n)“ „Cité universitaire“ waren nach der „Entfernung“ der als Urheber der Konflikte apostrophierten Mandatsträger der Residenten und ihrer Verteilung auf andere Wohnheime die Statuten des Hauses „den konservativeren Vorstellungen der Cité bezüglich studentischer Mitverwaltung“ angepasst worden. Was die „Störenfriede“ nicht daran gehindert habe, sich „maßgeblich an der häuserübergreifenden Entstehung einer 1973 beginnenden ‚Coordination des Comités des Residents de la CIUP‘ [zu beteiligen], die sich nach und nach in der Cité als mitbestimmendes Gremium durchsetzte und heute aus dem studentischen und demokratischen Leben der Cité nicht mehr wegzudenken ist. Lernprozesse waren wohl auf beiden Seiten vonnöten“. Zurück
- Siehe u. a. Otmar Seul: Arbeitnehmerpartizipation im Urteil der französischen Gewerkschaften. Sozialreformen unter der Präsidentschaft François Mitterrands (1982–1985), Saarbrücken 2012 (Neudruck meiner Dissertation von 1986), 530 Seiten; Peter Jansen, Otmar Seul (Hg.): L’Europe élargie: la participation des salariés aux décisions dans l’entreprise. Traditions à l’Ouest, innovations à l’Est?, Bern u. a., 2009, 430 Seiten. Zurück
- Siehe Otmar Seul: Apprendre l’Europe. Les Universités d’été franco-allemandes et européennes comme vecteur de la formation civique et citoyenne – éléments pour une synthèse géopolitique (2004–2020), Université Paris Nanterre, Cursus franco-allemands en sciences juridiques. URL: https://www.france-blog.info/wp-content/uploads/2020/09/Seul-O-Synthese-geopolitique-des-Universitees-d-ete-dec-2020.pdf (Abruf 3. Dezember 2021). Zurück
- Individuelle Karrieren, die 68er an die Schaltstellen von Staat und Gesellschaft brachten – wie erstmals unter der rot-grünen Regierungskoalition 1998–2005 – brachten Reformansätze mit Bezug auf Forderungen aus den 1960er und 1970er Jahren mit sich, zum Beispiel die Gleichstellung der Geschlechter, arbeits- und zivilrechtliche Gleichbehandlung, ökologische Steuerreform, Bundesnaturschutzgesetz, Energiewende (Atomkonsens/ Erneuerbare-Energien-Gesetz). Zurück